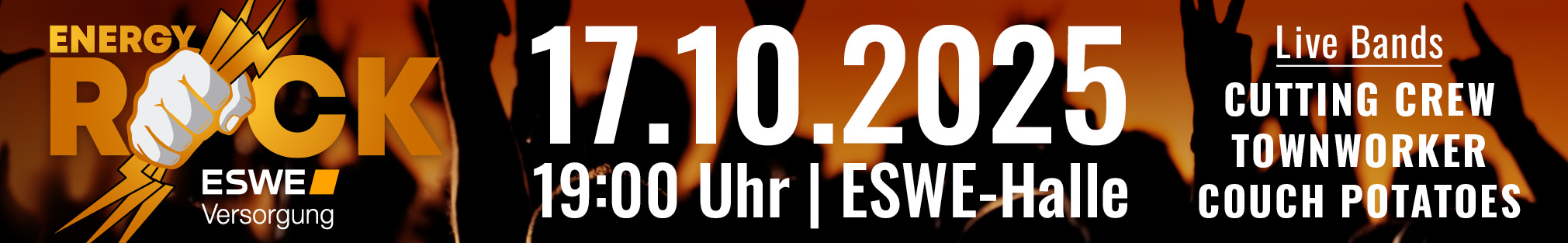Sirenen heulen, die Aula schweigt. Kurze Unterbrechung, dann sprechen sie wieder, erzählen Kindheitserinnerungen. Jugendliche fragen, hören, halten aus.
„Wir müssen die Erinnerungen wachhalten, damit so etwas Schlimmes nie wieder passiert.“ Das ist der Antrieb von Pfarrer Klaus Endter und den Zeitzeugen, die ab dem 7. September eine Reihe von Wiesbadener Schulen besucht haben, darunter auch der Campus Erbenheim der Obermayr Eurupa-Schule. Gegen 9:30 füllte sich das Theater am Campus Erbenheim, die Stimmen senkten sich, dann ein Gespräch, das selten geworden ist, begann.
„Zeichen der Hoffnung“: Wie eine Initiative Brücken schlägt
Pfarrer Enderweg erinnerte an die Gründung der evangelischen Initiative Zeichen der Hoffnung vor 48 Jahren – im Schatten der Frankfurter Auschwitz-Prozesse und der neuen Ostpolitik. Der Verein organisiert seitdem Freiwilligendienste, Studienreisen, Hilfen für Überlebende und eben jene Zeitzeugengespräche. In dieser Woche besuchten die „drei“ Zeitzeugen fünf Schulen – ein dichtes Programm, das die Begegnung bewusst in den Alltag holte.
Die Gäste: Bartnikowski, Wascher, Scharek
Im Mittelpunkt standen Bogdan Bartnikowski (93), Auschwitz-Überlebender, später Kampfpilot der polnischen Luftwaffe und Schriftsteller, sowie Barbara Doniecka, die als Zehnjährige nach Auschwitz verschleppt wurde. Als Vertreter der zweiten Generation sprach Cezary Naróg (54). Seine Mutter kam als Dreijährige in ein Außenlager des KZ Stutthof bei Danzig – nicht wegen „Tat“, sondern, weil die Familie dem deutschen Siedlungsprojekt im Osten weichen sollte.

Bartnikowski beschrieb die Deportation im August 1944: überfüllte Viehwaggons, Hitze, Durst, keine Toiletten. Nach 24 Stunden hielt der Zug in Birkenau. Er sah SS-Kolonnen, Hunde, Stacheldraht, und zwei Schornsteine, aus denen Flammen schlugen: „Ein süßlicher, schwerer Geruch hing über dem Lager.“ Es folgte die Selektion.
Doniecka schilderte die Ankunft im „Mikwe“, der entwürdigenden Wasch- und Desinfektionsprozedur, das wahllose Einkleiden, falsche Schuhpaare, ein viel zu großes Kleid. Sie erzählte von Läusen und Wanzen, die nachts „wie Regentropfen“ von den Holzwänden fielen. Ihre Mutter erstritt für die Tochter eine andere Häftlingsnummer – aus nackter Überlebenslogik: Wenn die SS Zehnergruppen zur Strafe erschoss, sollte die Mutter zuerst getroffen werden, um dem Kind eine Chance zu lassen.
Rituale der Entwürdigung – und leise Solidarität
Bartnikowski kam als Zwölfjähriger in einen Jugendblock des Männerlagers. Kapos zwangen die Jungen zu sinnloser „Gymnastik“, zu Kniebeugen und Liegestützen – Disziplinierung durch Erschöpfung. Abends, nach dem Appell, flüsterten die Kinder von Schule, Weihnachten, den Straßen Warschaus. Diese Erinnerungen wurden zur inneren Fluchtlinie. Sie sangen ein religiöses Lied – „Alle unsere täglichen Dinge nehmen wir mit Gnade an“ –, wenige Minuten Trost gegen die Verzweiflung.
Die zweite Generation: Schweigen, das prägt
Bei Naróg zuhause schwieg die Mutter lange. Erst beiläufig brachen Bruchstücke durch – etwa, als der Sohn seinen Lebenslauf schrieb und sie betonte, was im Lager das Überleben sicherte: die Eigenschaften gesund, kräftig, arbeitsfähig. Der Satz verrät mehr als jede Chronik. Später suchte die Familie das Gespräch – und traf wie an der Obermayr Europa-Schule am Campus Erbenheim Schülerinnen und Schülern, die offen fragen stellten und respektvoll zuhörren.

Ein Ort mit Geschichte: Spuren am Schulhaus
Schulleiter Dr. Gerhard Obermayr erinnerte an die Familie Dr. Katzenstein, die in den 1920er-Jahren am Standort in Erbenheim Arzneimittel („Resinetten“) herstellte – ein Hinweis darauf, dass Gebäude Biografien speichern. Wiesbaden knüpft seit Jahren an diese Erinnerungsarbeit an; die Stadt zeichnete Bogdan Bartnikowski jüngst mit der Silbernen Bürgermedaille aus – nicht als Ehrengabe, sondern als Auftrag, weiter zu erzählen.
Warnsirenen im Jetzt: Warum Erinnerung Politik bleibt
Als gegen 11 Uhr die bundesweite Warnübung die Handys in der Aula aufheulen ließ, erklärte der Gastgeber kurz Hintergründe. Die Szene passte ins Bild: Zivilschutz kehrt ins öffentliche Bewusstsein zurück – nicht aus Nostalgie, sondern, weil Europa erneut Krieg erfährt. Erinnerung warnt, sie ordnet Gegenwart, sie fordert Haltung.
Warum sie zurückkehren
„Das ist keine Freude“, sagte Bartnikowski über seine Auftritte. Jede Erzählung reißt Wunden wieder auf. Aber er sieht Fragen, Interesse, Anteilnahme – und spürt Pflicht. Nicht, um Schuldgefühle zu schüren, sondern um Nationalismus und Hass entgegenzutreten. Doniecka berichtete von ihrer Angst vor Hunden bis heute; Naróg von Sätzen, die das Lager in die Nachkriegsköpfe legte. Gerade deshalb tragen solche Gespräche: Sie binden Erfahrung an Sprache – und Sprache an Verantwortung.

Was bleibt
Die Jugendlichen notierten, fragten nach Nummern, nach Kleidung, nach Hunger, nach dem ersten Bild in Auschwitz. Sie hörten von Wahlverwandtschaft in der Baracke, von geteiltem Brot, von Liedern, die kurz trugen. Am Ende bleibt, was diese Woche intendierte: Erinnerung als Begegnung. Nicht als Pflichtübung, sondern als Dialog, der Zukunft wagt.
Alle Fotos ©2025 Volker Watschounek / Wiesbaden lebt!
Weitere Nachrichten aus dem Stadtteil Mitte lesen Sie hier
Mehr Informationen hier.
Mehr zur Künstlergruppe 50 in Wiesbaden.
Roter Faden für Zeitzeugengespräche.
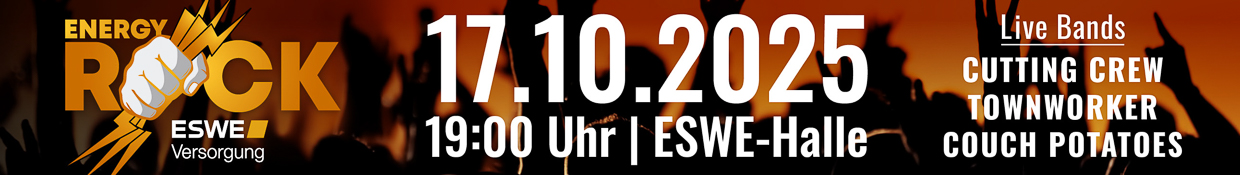





 Tag der Menschenrechte: Ein Aktionstag voller Denkanstöße
Tag der Menschenrechte: Ein Aktionstag voller Denkanstöße  Neue Ampel am Knotenpunkt Berliner Straße/Kreuzberger Ring
Neue Ampel am Knotenpunkt Berliner Straße/Kreuzberger Ring  Auslandsjahr: Auf in die Welt – Bildung ohne Grenzen
Auslandsjahr: Auf in die Welt – Bildung ohne Grenzen  Sommerfest: Eine Reise durch Europa
Sommerfest: Eine Reise durch Europa  Mathematik-Wettbewerb: Sechs Wiesbadener Schüler siegreich
Mathematik-Wettbewerb: Sechs Wiesbadener Schüler siegreich  Sankt Martin am Warmen Damm
Sankt Martin am Warmen Damm